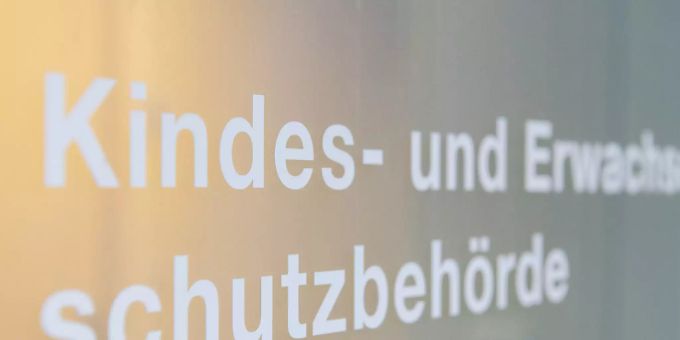Selbstbestimmung kommt im Schweizer Sozialwesen zu kurz

Im Schweizer Sozialwesen werden Rechte von Menschen in prekären Situationen teilweise missachtet. Die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte im Kindes- und Erwachsenenschutz wurden in der Praxis nur teilweise umgesetzt. Dies zeigt ein Nationales Forschungsprogramm.
«Der Weg zu einem besseren Kindes- und Erwachsenenschutz muss konsequent fortgeführt werden», sagte Alexander Grob am Donnerstag vor den Medien. Er leitete das Nationalen Forschungsprogramms «Fürsorge und Zwang» (NFP 76) des Schweizerischen Nationalfonds (SNF). Es sei an der Zeit, die neuen Kenntnisse umzusetzen.
In vielen Bereichen seien Verbesserungen zwar umgesetzt worden. Besonders in Bezug auf Mitwirkung der betroffenen Personen gebe es noch viel zu tun, hiess es im Abschlussbericht des NFP 76. Gesetzlich legitimierte Massnahmen seien in gewissen Situationen nach wie vor mit Zwang verbunden oder würden von Betroffenen als Zwang wahrgenommen.
Transparenz und Rechtssicherheit nicht gegeben
Zudem führen die kantonalen Zuständigkeiten und die komplexe Behördenorganisation zu Rechtsungleichheiten, betonten die beteiligten Forschenden. Betroffene würden oft nicht verstehen, was passiere, sagte Grob. Etwa wegen sprachlicher Barrieren. Transparenz und Rechtssicherheit seien für diese Personen so nicht gegeben.
Dazu gehört auch ein Finanzierungsmix, an dem gleichzeitig Bund, Kantone und Gemeinden beteiligt sein können. Wie genau die Finanzierung geregelt ist, kann laut dem Forschungsprogramm etwa die Anzahl an Fremdplatzierungen beeinflussen. Liegt die Entscheidung für eine solche bei den Gemeinden, die auch für die Sozialhilfe zuständig sind, werden beispielsweise weniger Fremdplatzierungen angeordnet, als wenn kantonale Verwaltungsbehörden oder Gerichte entscheiden.
Das NFP 76 kommt zum Schluss, dass die Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz auf Bundesebene harmonisiert werden sollen. Ausserdem legt es nahe, die Finanzierung so zu regeln, dass Fehlanreize vermieden werden. Und genügend Ressourcen zur Verfügung stehen.
Forschungsprogramm ist Teil des Aufarbeitungsprozesses
Das vom Bundesrat in Auftrag gegebene Forschungsprogramm ist Teil des Aufarbeitungsprozesses zu den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen. Mehrere Hunderttausend Menschen – die genaue Zahl lässt sich nicht feststellen – waren im 20. Jahrhundert von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen betroffen. Viele wurden Opfer von Misshandlung, Missbrauch und wirtschaftlicher Ausbeutung.
Dazu gehören unter anderem Kinder, die aus ihren Familien genommen und in Heimen oder Pflegefamilien untergebracht wurden, sowie Erwachsene, die man in Anstalten versorgte, ohne dass sie eine Straftat begangen hatten. Ausserdem auch ledige Frauen, die gedrängt wurden, ihre Kinder zur Adoption freizugeben, oder Menschen, die Opfer medizinischer Zwangsbehandlungen oder von Medikamentenversuchen wurden.
150 Forschende an 29 Projekten beteiligt
«Das Forschungsprogramm kann das Leid der Betroffenen nicht mindern», sagte Grob. Trotzdem sei es notwendig gewesen. Es trage dazu bei, die Erinnerungen an die Vergangenheit wach zu halten.
Viele ehemalige Opfer dieser Massnahmen würden bis heute darunter leiden, erklärten die Forschenden. So zeigte etwa ein Projekt, dass Menschen, die in den 50er-Jahren als Säugling fremdplatziert wurden, heute gesundheitlich schlechter dastehen als andere. «Es hat etwa die gleiche Auswirkung wie Rauchen», sagte Patricia Lannen, die dieses Forschungsprojekt leitete.
Am NFP 76 waren rund 150 Forschende beteiligt, die in 29 Projekten geforscht haben. Das Programm wurde als Teil des Aufarbeitungsprozess zu fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vom Bundesrat in Auftrag gegeben. Es kostete 18 Millionen Franken.